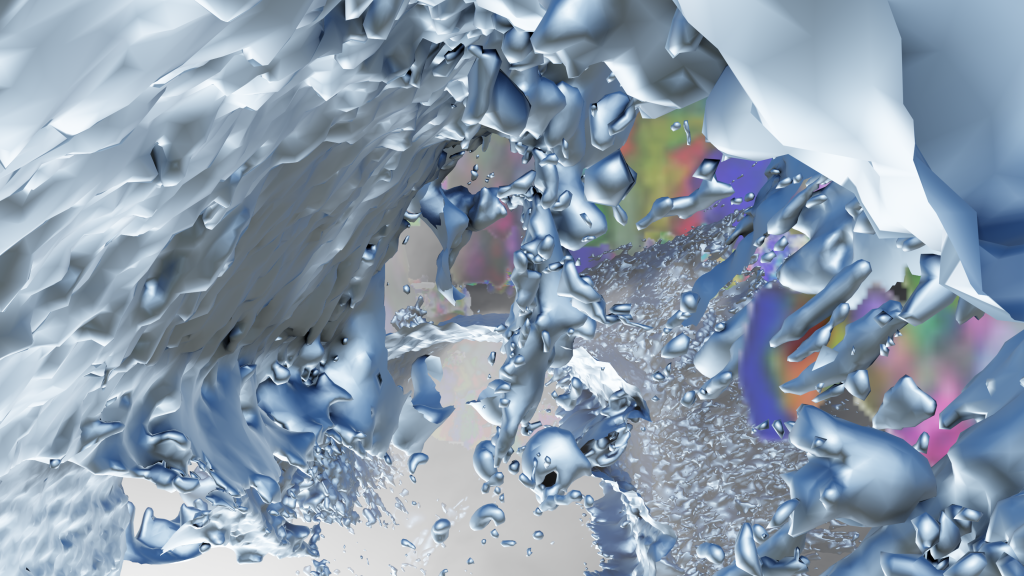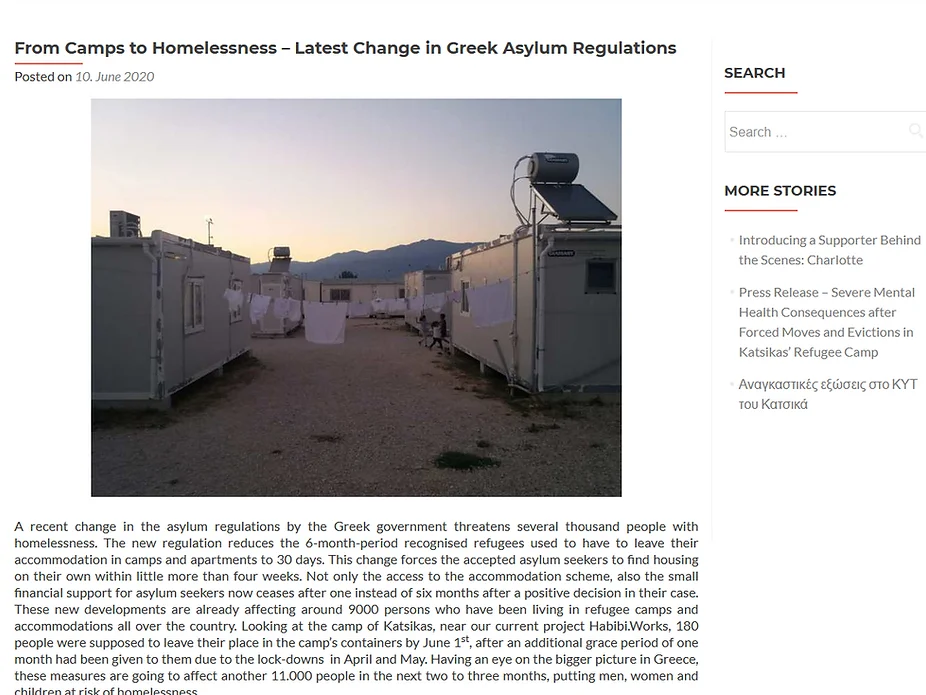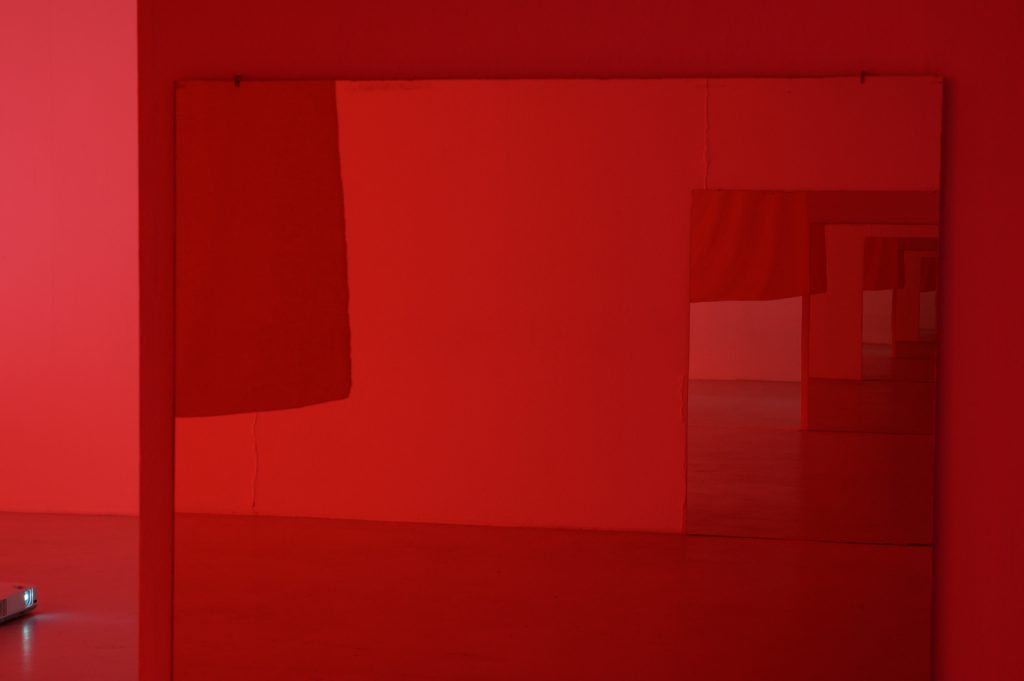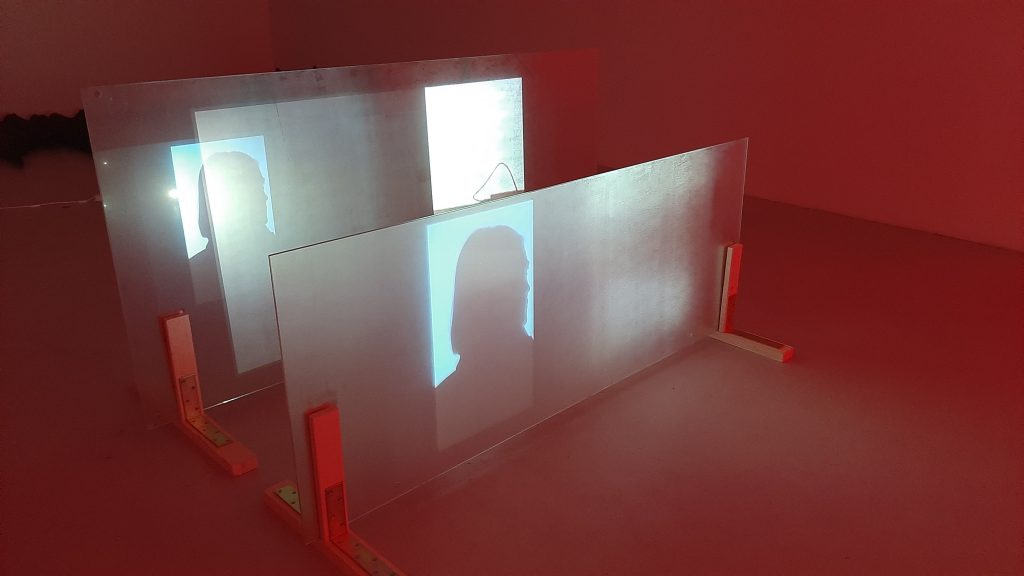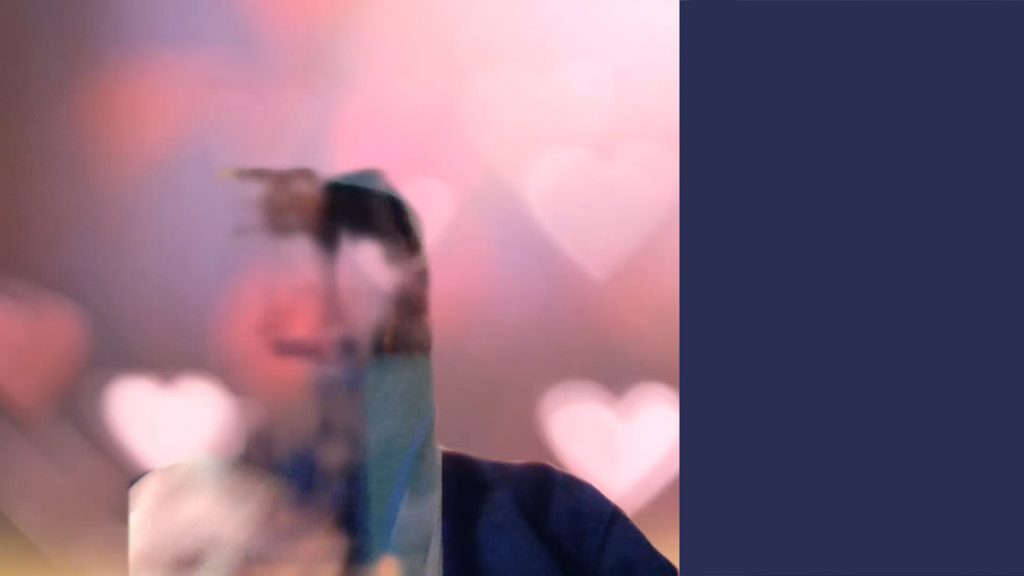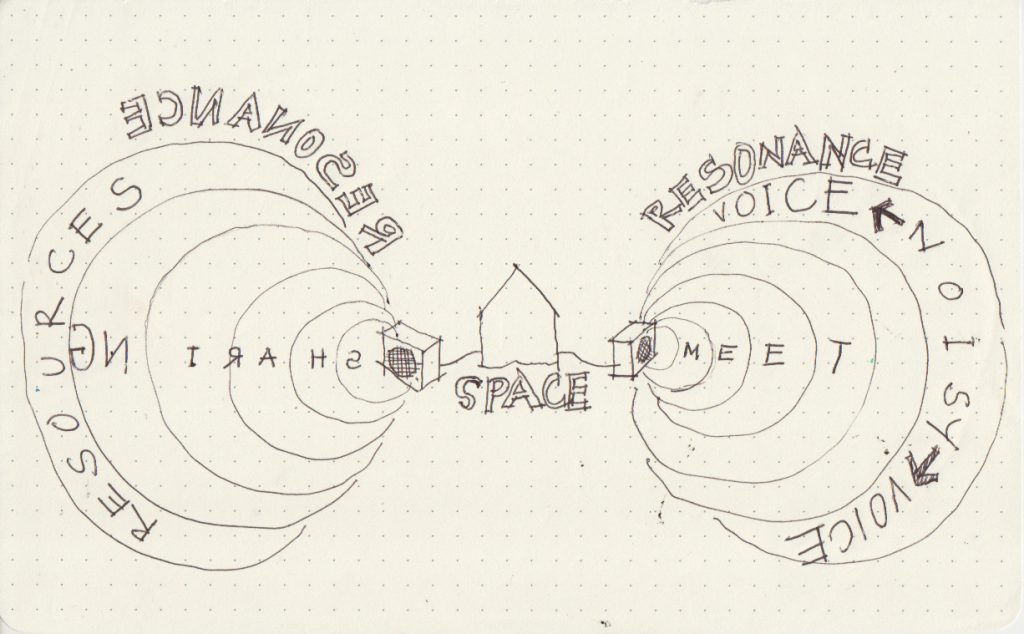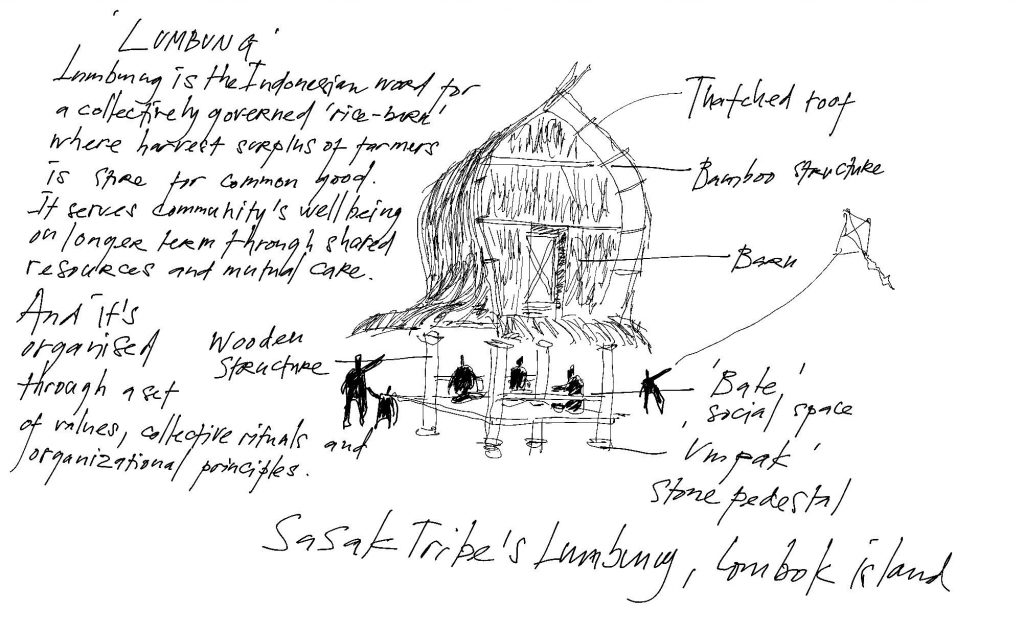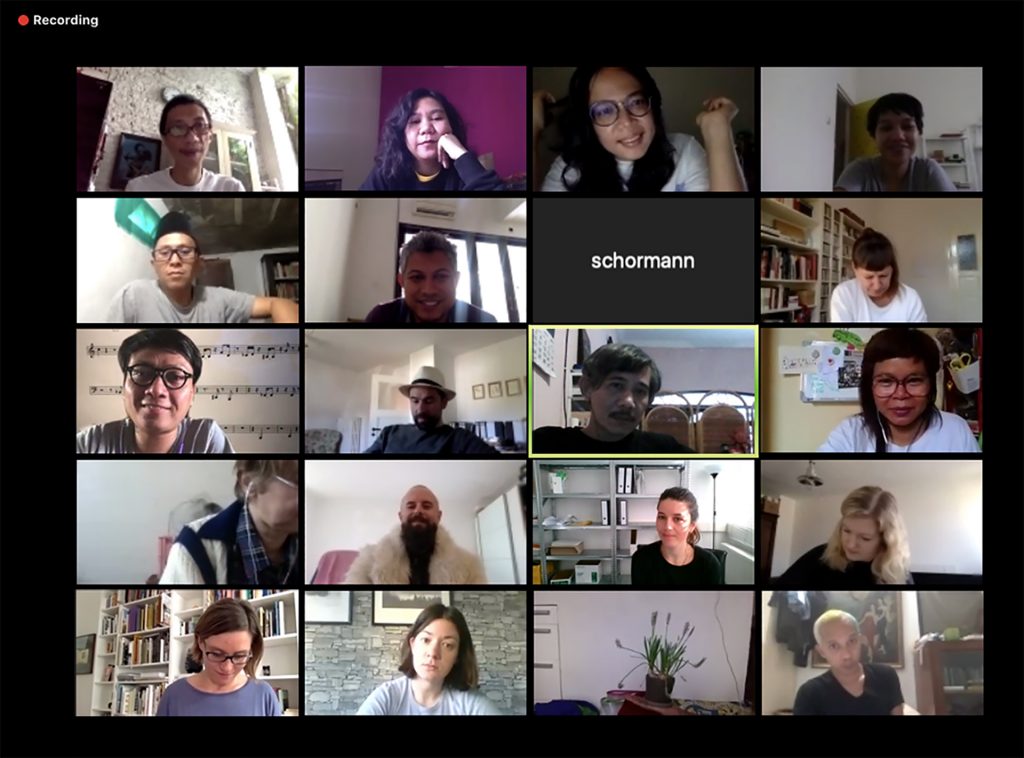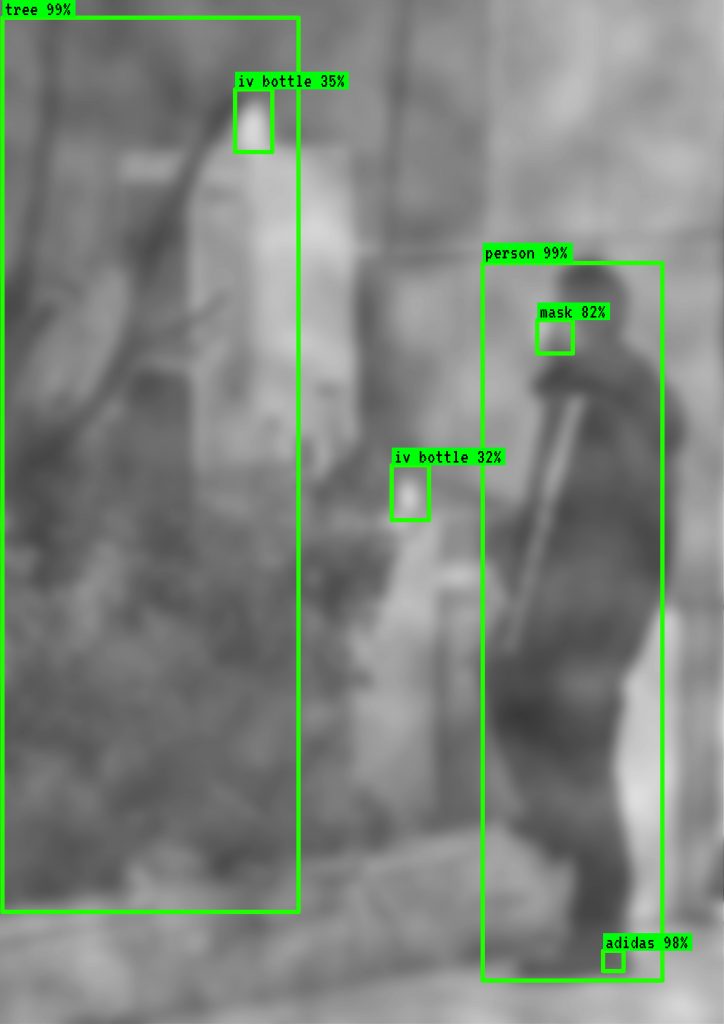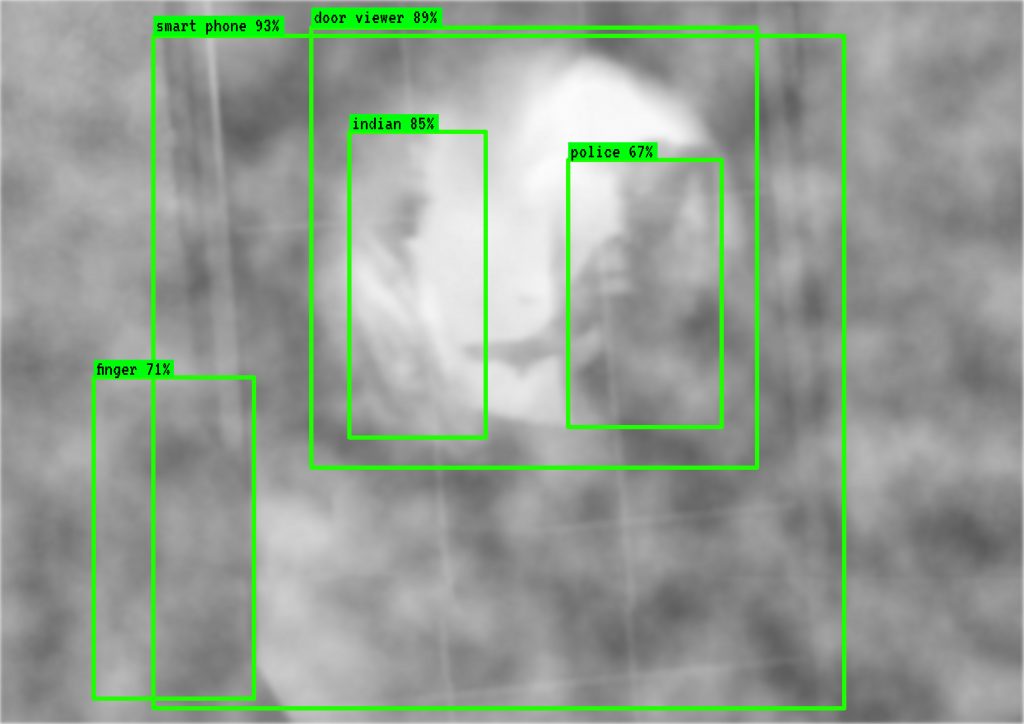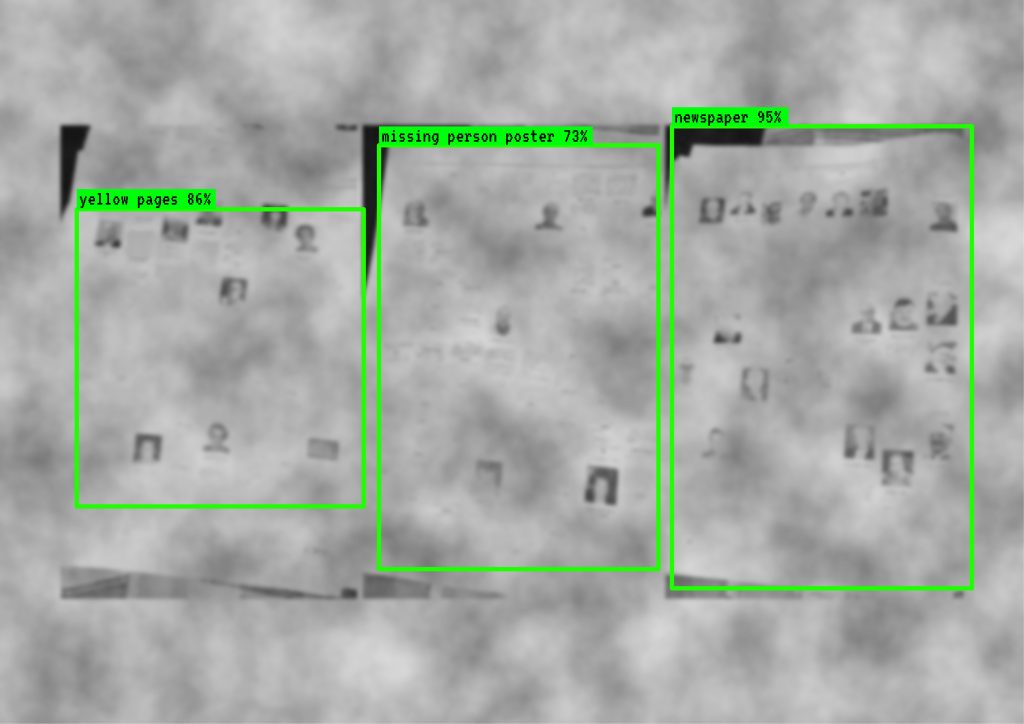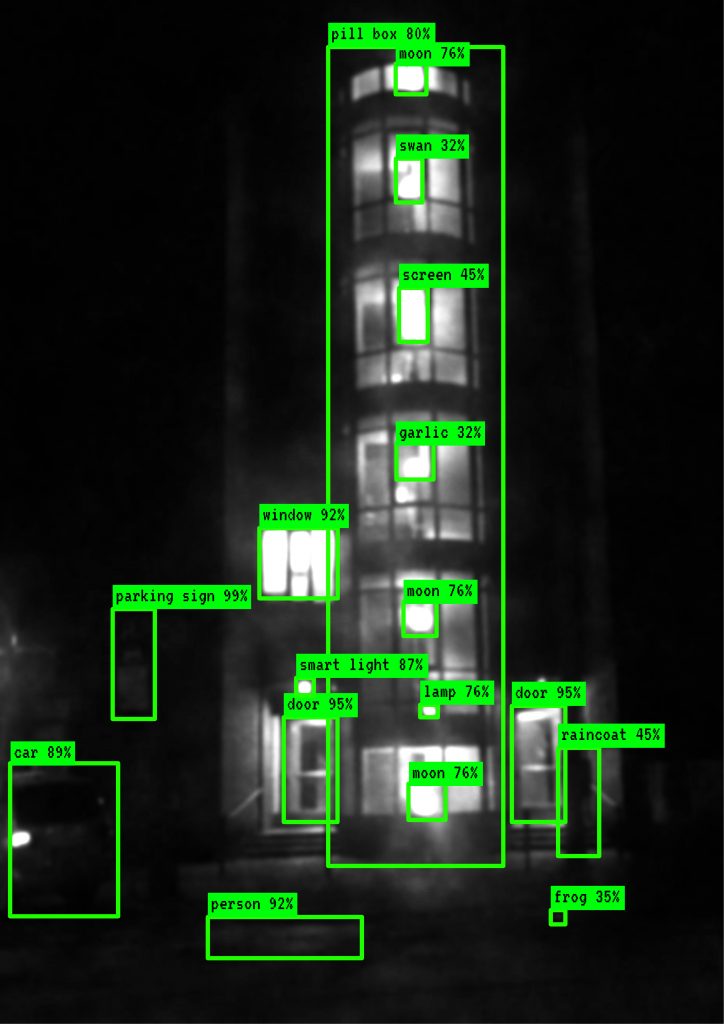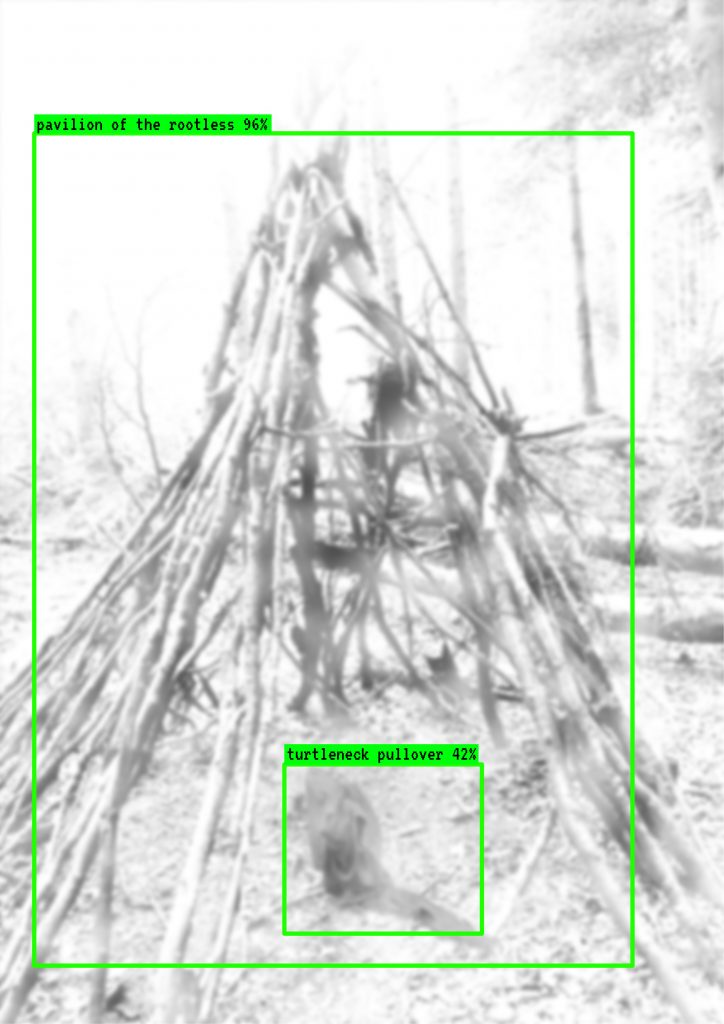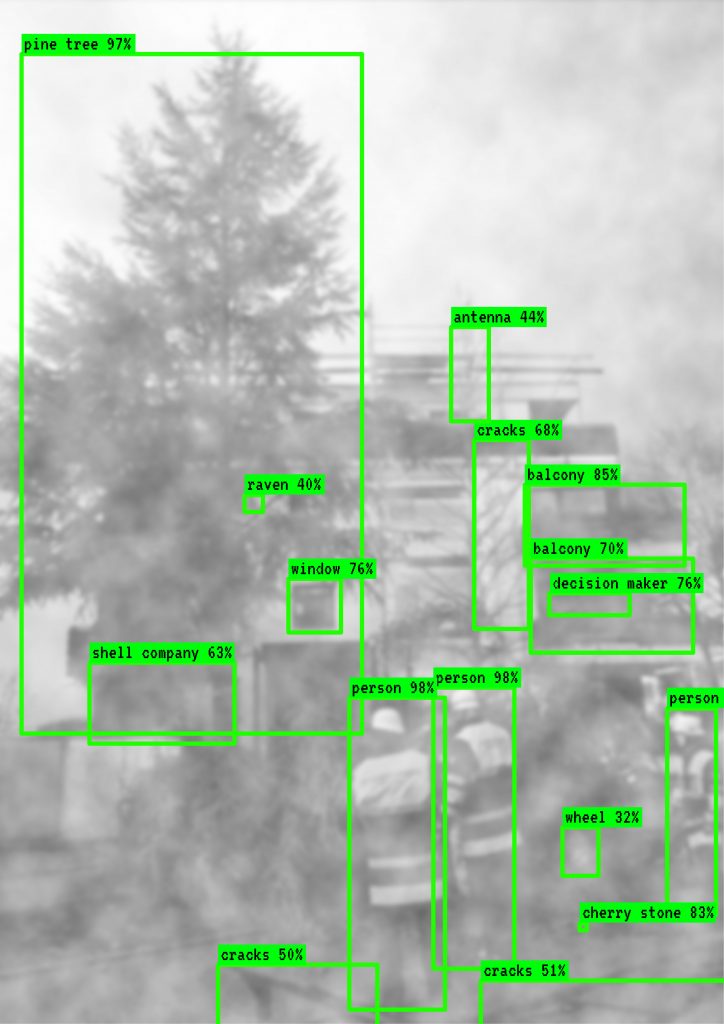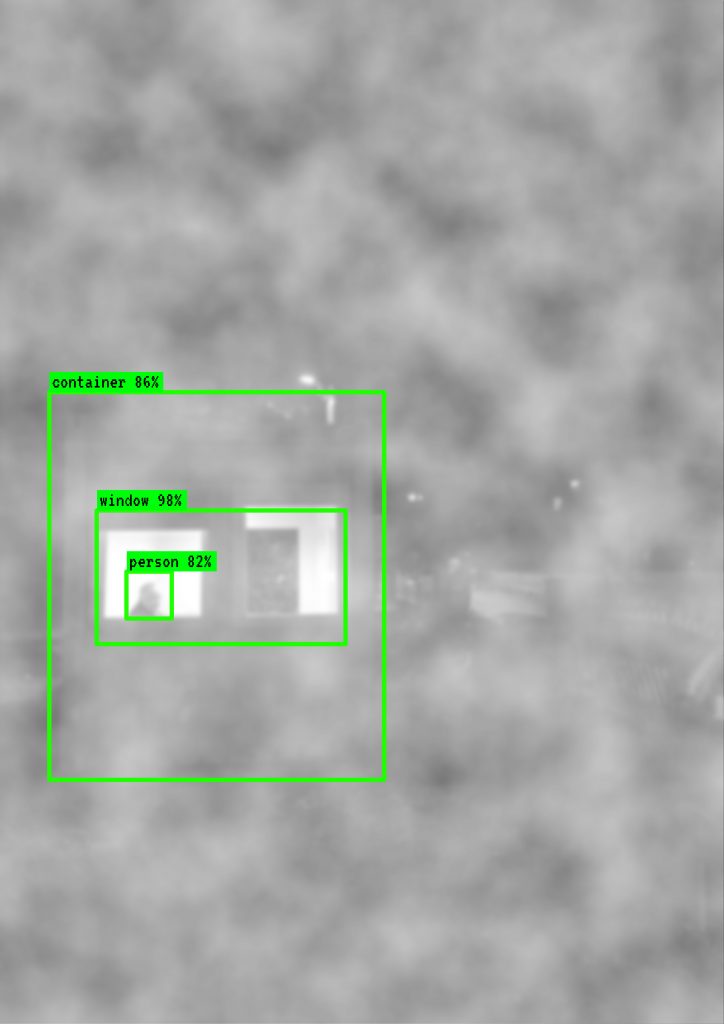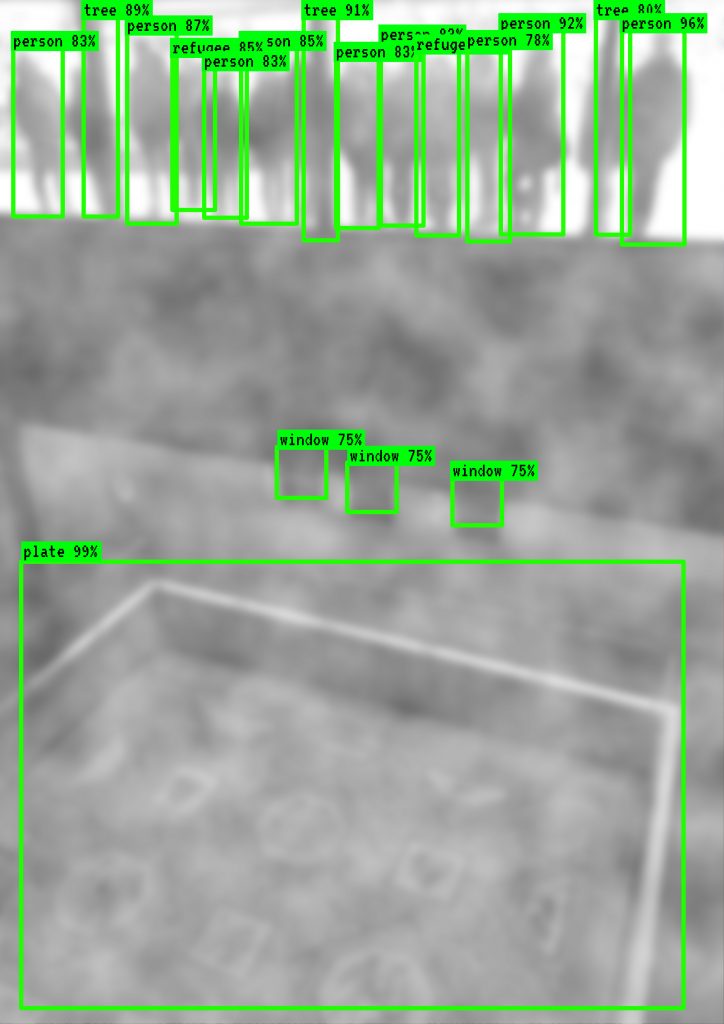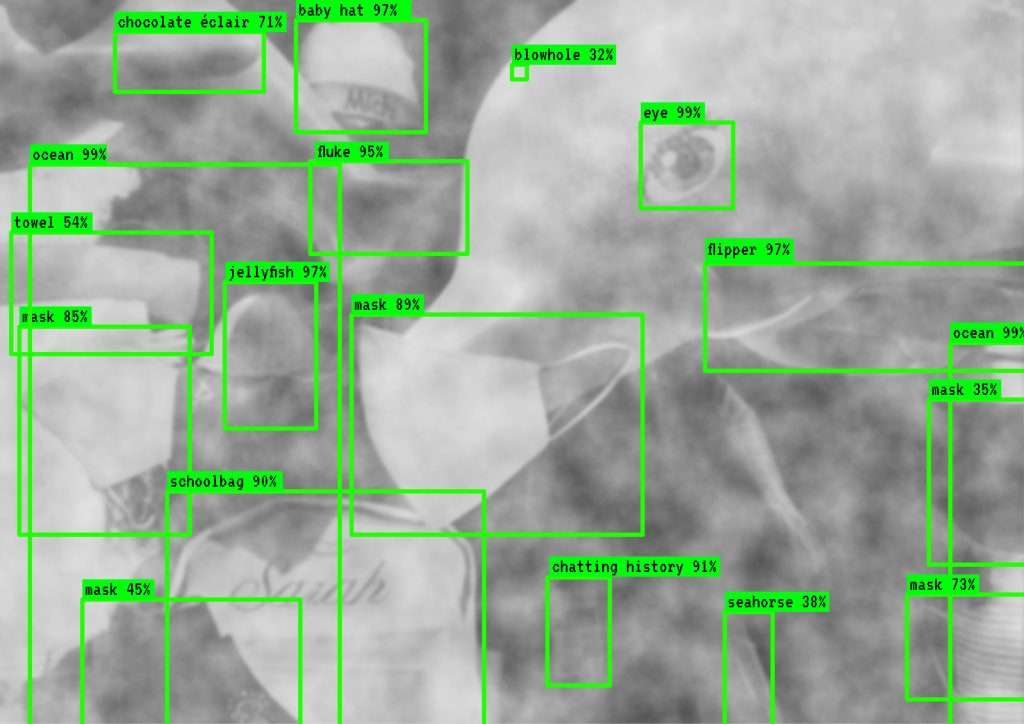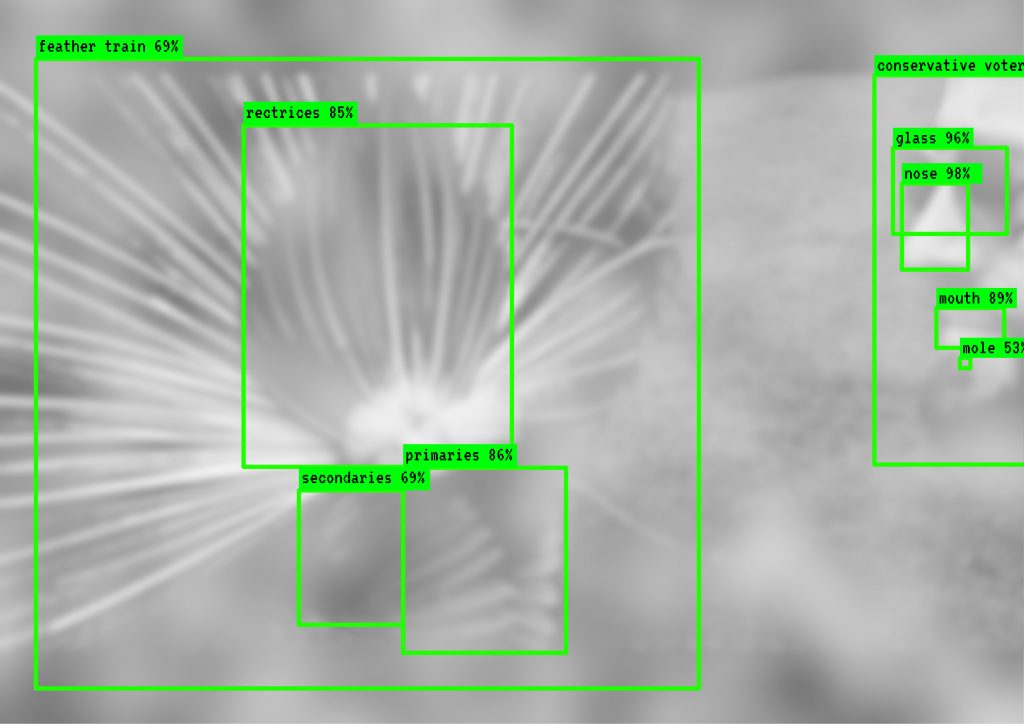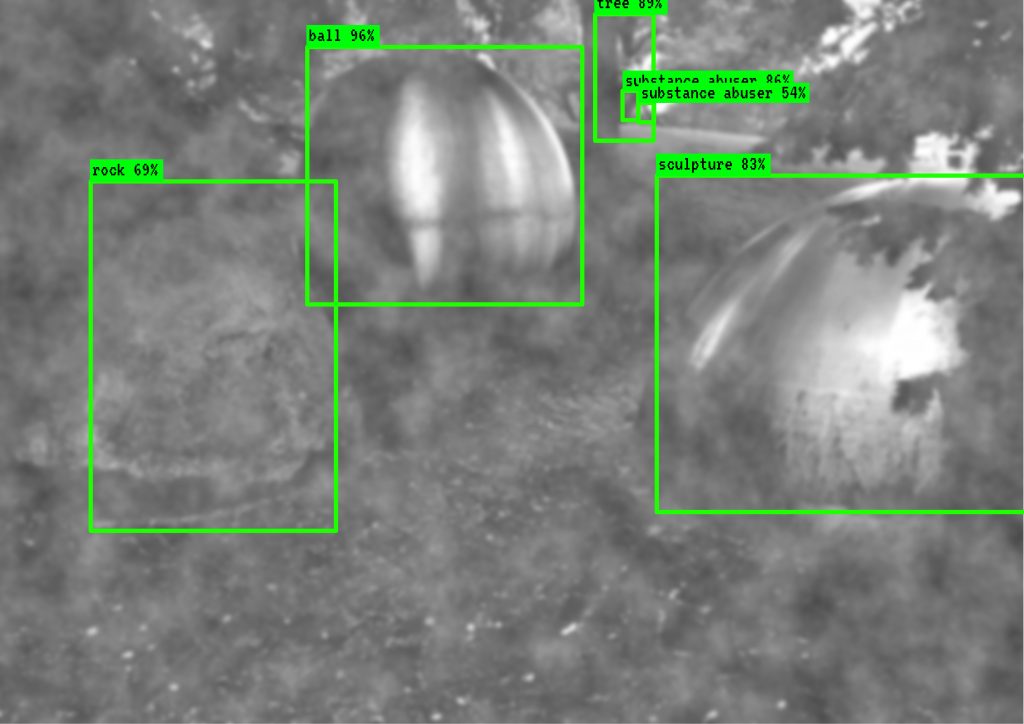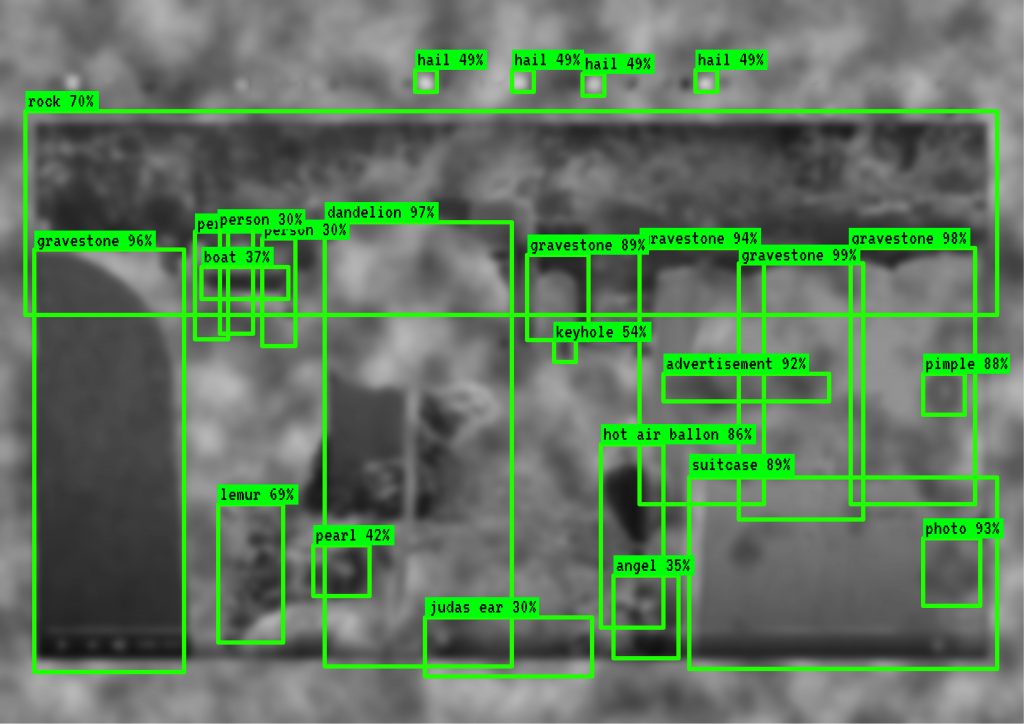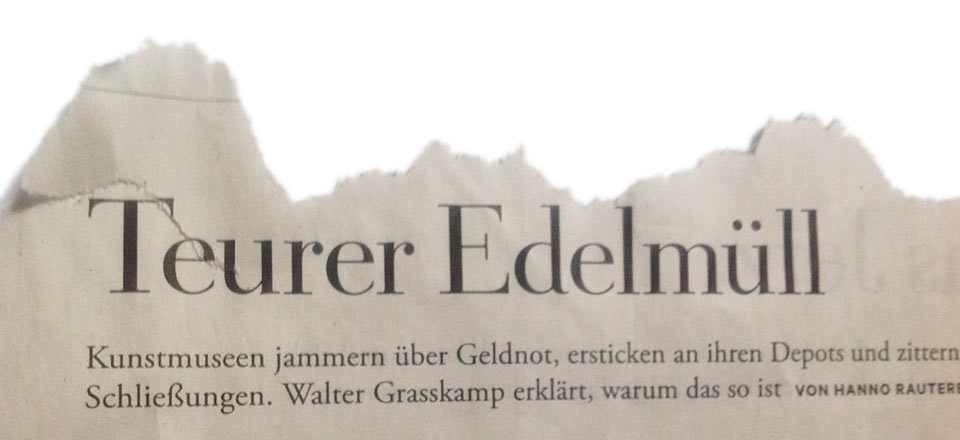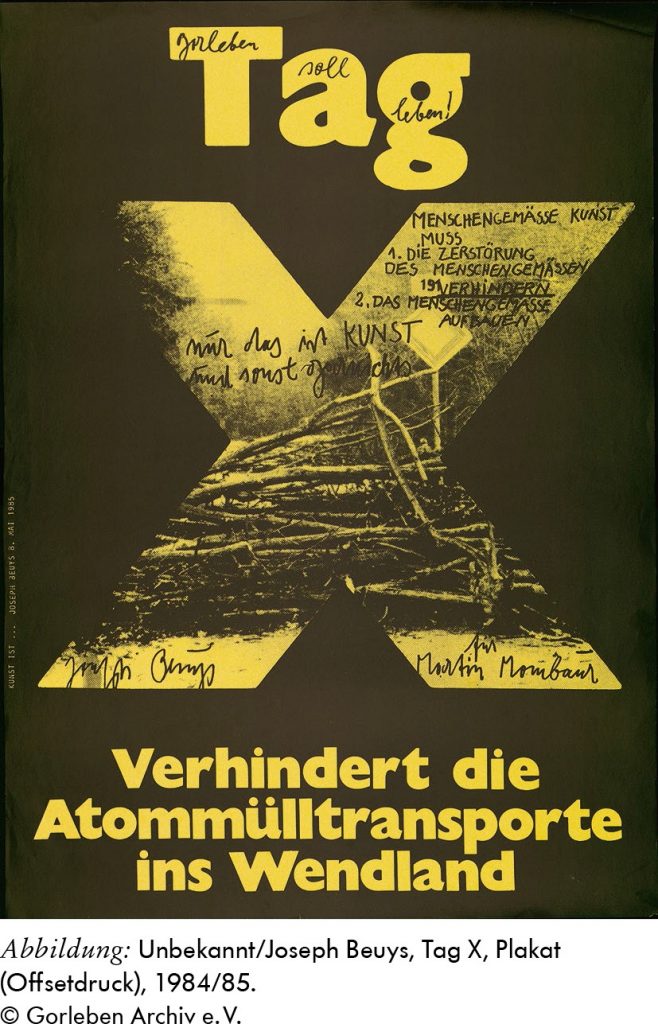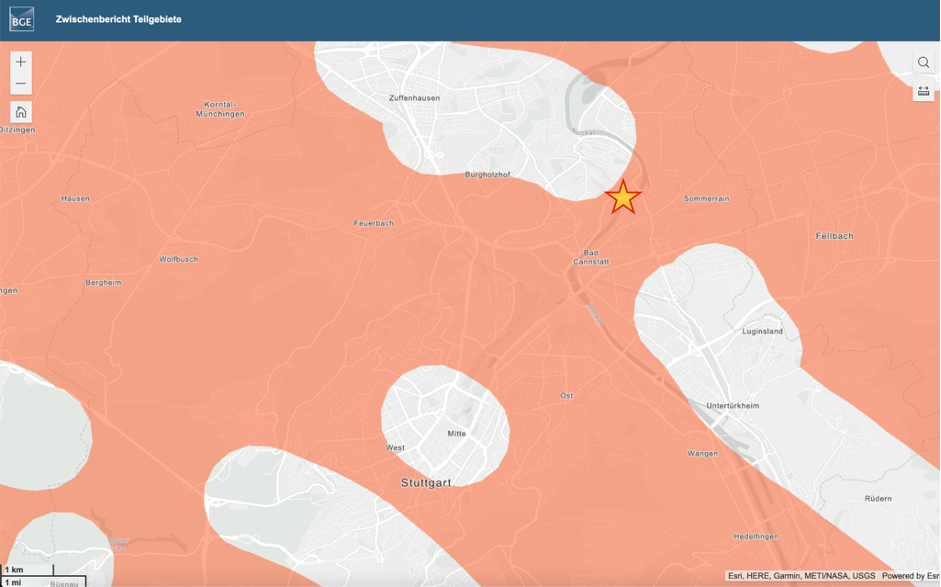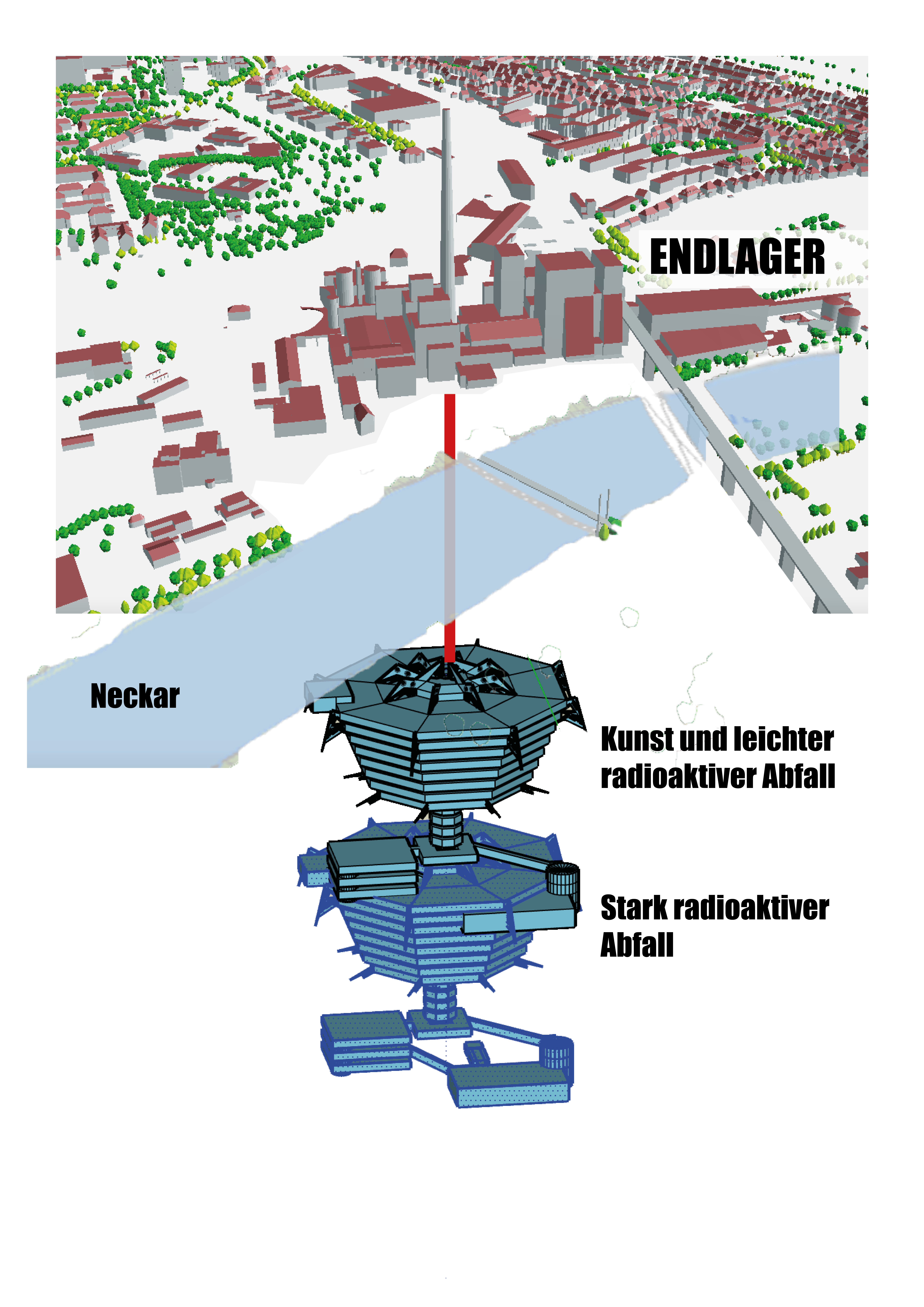In seinem Text Orte zur Imagination der Zukunft. Das Labor als Heterotopie versucht Nils Mojem der Frage nachzugehen wie und wo Utopien imaginierter Zukünfte auf reale Räume der Gegenwart treffen. Dabei soll der Fokus dem Forschungslabor als Heterotopie gelten, um einen Raum zu untersuchen, der durchzogen ist von hierarchischen Strukturen und sich über einen exklusiven Zugang durch Wissen auszeichnet. Es wird die Frage gestellt, wer wo, wann und für wen welche Zukünfte herbeiführen kann, soll und darf.
Ein großes Thema der Gegenwart ist es die Welt zu retten. Ausgehend von den aktuellen Krisendiskursen, die sich letztendlich in der Erkenntnis einer multiplen Krise von Menschheit und Planet im Zeitalter des Anthropozän verdichten, scheint die Gestaltung wünschenswerter Zukünfte notwendiger und dringlicher denn je. Und obwohl Zukünftiges stets ungewiss ist, Möglichkeit bleibt und nie etwas Faktisches darstellt, schließt doch die Imagination dessen, was werden kann oder soll, sowohl Möglichkeiten der Kritik des Gegenwärtigen als auch die Annahme der Einflussnahme auf das Zukünftige mit ein. Ausgehend von dem narrativen Charakter menschlicher Erfahrungsbildung, sind es also Imaginationen, die als kulturelle Praktiken „eine mitunter sprachlose Ungewissheit in Handlungsentwürfe überführen.“
Dabei sind die Imaginationen der Zukunft aufs engste mit den Erzählungen der Gegenwart verknüpft. Und obwohl der überwiegenden Mehrheit der Erzählungen der Gegenwart das Anerkennen der multiplen Krise im Anthropozän gemein ist, werden dabei doch je nach Narrativ und Erzählposition „unterschiedliche Ursachen und Treiber […] sowie unterschiedliche Interventionsszenarien, Widerstandakteure und Transformationsträger identifiziert.“ Dies kann zwar als grundlegende Deutungsoffenheit von Geschichte/n ausgelegt werden, doch entpuppt sich diese Deutungsoffenheit im Übergang von Narration zu Imagination als das Verhandeln von Deutungsmacht. Dies vor allem, da sich durch die kulturelle Praxis der Imagination auch eine neue Form der Temporalität ergibt; aus einer ‚Zukunft‘ als singulärem Telos wird eine Multiplizität möglicher Zukünfte. Wenn nun die unterschiedlichen Imaginationen von Zukünften maßgeblich aus den jeweiligen Erzählungen der Gegenwart hervorgehen, in ihnen die Hauptakteure der Gegenwart Handlungsentwürfe entwickeln und ihre Geschichte fortschreiben, dann ist die Frage nach der Deutungsmacht bei den Erzählungen der Gegenwart eine entscheidende, gerade weil die Erzählungen von multipler Krise und Anthropozän das Schicksal der gesamten Menschheit und sogar des ganzen Planeten behandeln. So geht es darum, welche möglichen Zukünfte von wem – das heißt aber auch: wie, an welchen Orten und für wen – formuliert werden können, erdacht werden sollen und herbeigeführt werden dürfen.
So werden an unterschiedlichen Orten, von unterschiedlichen Gruppen verschiedene Zukünfte imaginiert, je nachdem, welches Narrativ sie nutzen, welche Werte und Annahmen ihren Erzählungen zu Grunde liegen, welche Erzählstruktur ihre Geschichte prägt und welche Hauptakteure dabei in ihren Handlungsentwürfen in den Fokus geraten. Entscheidend hierbei ist also auch der Modus, in welchem erzählt und gedacht, Gegenwart wahrgenommen und Zukünfte gestaltet werden sollen. Haraway formuliert dies folgendermaßen: „Es ist von Gewicht, welche Gedanken Gedanken denken. Es ist von Gewicht, welche Wissensformen Wissen wissen. […] Es ist von Gewicht, welche Erzählungen Erzählungen erzählen.“ Dies gilt es zu beachten, wenn an verschiedenen Orten die vermeintlich selbe Geschichte anders erzählt wird, unterschiedliche Zukünfte imaginiert werden. Denn trotz einer Pluralität der Geschichten der Gegenwart und der Imaginationen von Zukünften gibt es doch solche Erzählungen, die mehr Gehör finden, gibt es Sprecher:innen, die eine besonders dominante Rolle in der Erzählung von Gegenwart und Zukunft einnehmen, Orte, an denen gesprochen eine besonders prominente Sprecher:innen-Position eingenommen wird.
Einem bestimmten Ort kommt dabei ganz besondere Bedeutung zu: Es ist das Forschungslabor – ein merkwürdiger, von Macht und Wissen durchzogener Raum, in dem zeitliche und räumliche Strukturen aufeinandertreffen und sich in einer eigenartigen Verbindung mit- und durcheinander fortsetzen. Als Institution der Wahrheitsfindung, des Wissens und der Innovation nimmt das Forschungslabor einen bedeutenden Platz innerhalb der Gesellschaft ein und stellt dennoch einen eigenartig von der Gesellschaft abgesonderten Raum dar. Weil der Zugang zu ihm exklusiv und an Wissen gebunden ist, besitzt es einen ein- und ausschließenden Charakter. Das in ihm aufgeführte Expert:innentum begründet seine narrative Kraft – die Möglichkeit der Kritik ist an einen Zugang zu ihm, an eine Übernahme des ihm eigenen Forschungsmodus gebunden. Das Forschungslabor ist überall auf der Welt zu finden und tritt dabei merkwürdig mit sich selbst in Kontakt; sein gleichzeitiger Betrieb an unterschiedlichen Orten wird durch eine strukturelle Identität, durch die standardisierten Bedingungen naturwissenschaftlicher Forschung ermöglicht; indem Experimente durchgeführt und Hypothesen geprüft werden, können durch die nüchterne Sachlichkeit naturwissenschaftlicher Forschung vermeintlich objektive Wahrheiten erzeugt und anschließend in anderen Laboren falsifiziert werden. Seine Exklusivität als geschlossener Raum, als Hort des Wissens und der Wahrheit bleibt gerade dadurch erhalten. Doch auch zum ‚Außen‘, zur Mit- und Umwelt steht das Labor in einer merkwürdigen Verbindung, welche überhaupt erst eine standardisierte Forschung durch das naturwissenschaftliche Experiment ermöglicht und gewährleistet: Dadurch, dass das Labor sich selbst von der Welt abgrenzt, ausschließt, dabei gleichsam aber ein Stück der äußeren Welt in sich einschließt, können Forschende eine eigenartige Macht über die natürlichen Untersuchungsobjekte erlangen, gerade weil sie diese in eine technisch-kulturelle Umgebung verlagern.
Nicht nur durch seine Exklusivität, seine eigenartige Position innerhalb der Gesellschaft, seinen Bezug zum Innen und Außen kann das Labor als Heterotopie im Sinne Foucaults bezeichnet werden. Es übt auch eine eigenartige Brückenfunktion aus, verbindet unterschiedliche Zeitlichkeiten und setzt verschiedene Räume miteinander in Verbindung. So wird in Bezug auf die Erzählung der Gegenwart und die Imagination von Zukünften hier entweder versucht die Realität der Gegenwart in eine imaginierte Zukunft zu überführen oder aber eine fiktive und imaginierte Zukunft schon in der Gegenwart Realität werden zu lassen.
In diesem Bestreben und mit dem eigenen Modus der Forschung steht das Labor als Forschungsstädte auch für eine besondere Auffassung des Verhältnisses vom Menschen zur übrigen Welt: Mittels technischer Verfahren können und sollen die Geheimnisse der Natur entschlüsselt und der Menschheit nutzbar gemacht, um letztlich jedoch ihrem Willen untergeordnet zu werden. In diesem Konzept der Nutzbarmachung wird Natur zum bloßen Erkenntnisobjekt, zum Untersuchungsgegenstand und zur gewinnbringenden Ressource degradiert, die mit Hilfe technischer Eingriffe und Verfahren gewissermaßen manipuliert und dann möglichst profitabel durch den Menschen selbst geformt werden kann. Maßgeblich hierfür ist ein rationalisierter Erkenntnisprozess: Mit Kultur und Technik tritt der Mensch der Natur entgegen, stellt sich ihr gegenüber, analysiert, seziert, benennt und ordnet, erschließt Zusammenhänge und erzählt dabei eine Geschichte der Trennung von Natur und Kultur, erzählt eine Geschichte von Erkenntnis, Fortschritt und Innovation, erzählt gewissermaßen eine Geschichte der Naturmachtbefähigung des Menschen.
Ausschlaggebend ist dabei die Form des Wissens, die den Menschen zur Beherrschung der ihm äußerlichen Natur befähigt. Analog zum Dominium terrae des Alten Testamentes ist es hierbei nicht göttlicher, sondern menschlicher Wille, der dem Menschen die Natur zum Untertanen macht, es ist keine göttliche, sondern eine menschliche Ordnung, eine auf rationaler Erkenntnis beruhende menschliche Anordnung, die zu eben jener Naturmachtbefähigung führt.
Entscheiden daran ist, dass dieser Modus der Mensch-Natur-Begegnung sich erst im Verlauf der europäischen Wissensgeschichte entwickelte: Durch den an vielen Stellen auf Descartes‘ Trennung von Körper und Geist zurückgeführten Prozess der Rationalisierung etablierte sich seit Beginn der Neuzeit in Europa jenes dichotome Denkmodell, welches sich bis in unsere Gegenwart fortschreiben sollte und mit Blick auf die expansive, koloniale und imperialistische Geschichte Europas gar als dichotomer Wahn bezeichnet werden kann. Die philosophischen Abstraktionen Descartes‘ wurden dabei zu praktischen Herrschaftsinstrumenten, sie „waren reale Abstraktionen mit gewaltiger materieller Kraft“, welche die moderne Logik von Macht und Denken nachhaltig prägten. Diesem Denken entsprangen hierarchische Ordnungsentwürfe entlang von raum-zeitlichen Achsen, Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse konnten so im Sinne der Ordnenden legitimiert werden, wobei die vermeintliche Überlegenheit der Ordnenden sich selbst aus ihrer Rationalität heraus begründete.
Die Rationalisierung der Welt war dabei aber auch auf das engste mit dem Festigen eigener Macht, der Akkumulation von Kapital und dem Bestreben einer Steigerung der Produktion verbunden. Schon in frühen Phasen des heute so unübersehbar ausufernden Kapitalismus waren Fortschritt und Wachstum an wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Innovationen und die etablierte Trennung von Natur/Kultur gekoppelt. In dem Moment, da Natur zur Ressource wird, wird sie gleichsam dem Wertgesetz unterworfen. Forschung und Technik sollen dabei im Rahmen des Wertgesetzes zur effizienteren Nutzung der Natur als Ressource, zu einer profitableren Aneignung ihrer Gaben und dem Aufrechterhalten der Möglichkeit ihrer Ausbeutung beitragen.
Interessanterweise ist also das naturwissenschaftliche Erkenntnisinteresse stets handlungsorientiert und zukunftsgerichtet und entwickelt sich dabei immer mehr oder weniger entlang an den Vorteilen und Interessen bestimmter Gruppen, am Nutzen zu einem bestimmten Zweck. Diese Erkenntnis ist wichtig und muss bei der Frage nach den Narrativen der Gegenwart und den Imaginationen von Zukünften berücksichtigt werden. Denn einerseits positionieren sich dabei die Naturwissenschaften durch ihren vermeintlich sachlich-rationalen Forschungsmodus als Hüter objektiver Wahrheiten, als Weltenentzauberer, die einer ordnungslosen Natur mit einer anordnenden und allgemeingültigen Logik begegnen. Andererseits aber gründet sich ihr Zugang zur Welt auf einer alten Denktradition der Trennung und Hierarchisierung, auf selbst erschaffenen und ebenso machtvollen Differenzen, durch die eine Handhabung der Natur als Objekt und Ressource erst ermöglicht wird. In diesem Sinne kann der Natur entgegengetreten werden, kann das Verhältnis von Mensch/Natur gestaltet werden. Wissenschaftliche Forschung und technischer Fortschritt sind reaktionsfähig und innovativ, sie können Lösungen für Probleme finden – Probleme, die aber zunächst definiert werden müssen. Hier zeigt sich wieder die Bedeutung von Narrativ und Imagination: Je nachdem, welche Geschichte erzählt, welche Probleme definiert werden, wird Zukunft unterschiedlich imaginiert, werden bestimmte Lösungen gesucht und gefunden, sollen bestimmte Szenarien herbeigeführt werden und bieten sich bestimmte Akteure für diese Aufgaben an.
Und genau hierbei gerät auch die besonders prominente Sprecher:innenrolle der Naturwissenschaften mit Blick auf die Erzählung der multiplen Krise der Gegenwart und der Imagination möglicher Zukünfte in den Fokus. Gefragt werden muss danach, wer das notwendige Wissen zum Erzählen der Geschichte, zur Imagination und Herbeiführung der Zukunft zur Verfügung stellt.
Wenig überraschend waren es Naturwissenschaftler, die den Begriff des Anthropozäns einführten, um damit den massiven menschlichen Einfluss auf das Erdsystem zu beschreiben. Die Nachweisbarkeit dieses Einflusses in den Sedimentschichten, der Atmosphäre, den Ozeanen, in belebter wie unbelebter Materie des Planeten gab ihnen Anlass dazu, vom Eintritt in ein neues, vom Menschen dominiertes Erdzeitalter zu sprechen. Und trotz heftiger Diskussionen über den Anfangspunkt oder die Benennung dieses neuen Erdzeitalters, wird dessen multiple Krise im allgemeinen Tenor doch an den erdsystemischen Materialitäten nachgezeichnet und, nicht zuletzt, am Klimawandel – als präsentesten Signifikanten – erkannt. So ergibt sich die dominante Sprecher:innen-Rolle der Naturwissenschaften im Anthropozän also aus dem Umstand, dass die vermeintlich zu behandelnden und zu untersuchenden Bereiche – Atmosphäre und Klima, Flora und Fauna oder chemische Stoffkreisläufen – klassischerweise alles Gebiete naturwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnis darstellen.
Gleichwohl wird der Begriff des Anthropozän mittlerweile diskursiv und disziplinübergreifend nicht nur in akademischen Kreisen, sondern längst auch in Kunst und Kultur behandelt. Dennoch treten nun, da die entzauberte Welt gerade auch aufgrund einer durch technische Innovationen ermöglichten und dem westlichen Wahn permanenten Wachstums unterworfenen Ausbeutung, Aneignung und Zerstörung der Natur aus den Fugen zu geraten scheint, die Naturwissenschaften neuerlich in den Vordergrund und positionieren sich als ebenso sachliche wie innovative Heilsbringer einer überforderten Weltgesellschaft. Vielerorts zeigt sich dies im Versuch, Hardwarelösungen für die multiple Krise zu finden; technische Innovationen dienen als Antworten auf Probleme, die zuvorderst an den erdsystemischen Materialitäten abgelesen und dann auch als erdsystemische Krisen erkannt werden.
Und zumindest mit Blick auf diese erdsystemischen Krisen wird vielerorts die prominente Erzählposition der Naturwissenschaften anerkannt, wird den Forschenden im Labor die legitime Sprecher:innenrolle zugewiesen, gelten ihre Narrative als die wahren, als faktisch und objektiv. Unter anderem zeigt sich dies auch in den politischen Maßnahmen, ihren Förderprogrammen und Nachhaltigkeitsinitiativen, als Versuch auf die multiple Krise im Anthropozän zu reagieren. Weil diese Krise von den erdsystemischen Materialitäten aus gedacht und auf die Form des Wirtschaftens samt dem massiven Verbrauch fossiler Rohstoffe zurückgeführt wird, gibt es unterschiedliche Bestrebungen, das Wirtschaften durch technische Innovationen hin zu einer ökologisch verträglicheren Form zu transformieren. Wenn durch die Form des Wirtschaftens die erdsystemischen Stoffkreisläufe gestört werden, das Klima sich wandelt, kurz: die Natur, bzw. der menschliche Zugang zu dieser Natur als Ressource und Objekt sich ändert, dann braucht es neue Macht- und Produktionsstrukturen, um der Natur begegnen zu können. Das heißt aber auch, dass der Kapitalismus als Modus des Wirtschaftens nicht in Frage gestellt, sondern lediglich auf neue Bereiche angewandt werden soll. Um die Produktivkraft, den Konsum und eine fortschreitende Akkumulation von Kapital zu erhalten, müssen neue Rohstoffquellen geschaffen und angeeignet, muss Natur durch wissenschaftliche Erkenntnis und technische Innovationen als zugänglich erhalten bleiben.
Somit wird Nachhaltigkeit häufig als Konzept verstanden, welches den Status Quo nicht nur kurzfristig, sondern auch zukünftig aufrechterhalten soll, wodurch die Programme einer ökologischen Modernisierung oftmals „[f]est verankert in Individualismus, liberaler Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft“ bleiben, dabei aber dennoch „die typischen Wertmuster und Strukturprinzipien spätmoderner Gesellschaften den veränderten Rahmenbedingungen ökologischer Grenzen“ anpassen sollen. In dieser Erzählung liegt ein Hauptaugenmerk auf den erdsystemischen Veränderungen, die bedeuten, dass das jahrhundertealte und funktionierende Verfahren der Aneignung und Ausbeutung der Natur gefährdet wird, dass die Naturbeherrschung neuer Formen von Wissen und Technik bedarf. In einer entsprechenden Imagination von Zukunft muss also den erdsystemischen Veränderungen durch Erkenntnis und Innovation begegnet werden: Unter veränderten klimatischen Bedingungen braucht es neue Formen der Landwirtschaft, andere Anbaumethoden. So der Verbrauch fossiler Roh- und Brennstoffe enden soll, bedarf es neuer Energie- und Rohstoffquellen. Zielsetzung ist, den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln und Energie ökologisch-nachhaltig zu decken. Allerdings geht es auch darum, der sich im Mensch/Natur-Verhältnis ändernden Natur mit Innovationskraft neuerlich im alten Modus der Aneignung und Ausbeutung, der Kontrolle und Verfügbarmachung begegnen zu können. Abermals zeigt sich die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die technische Rationalität unter dem uneingeschränkten Diktat des Tauschwertes deformiert.
Und dennoch liegt in diesem Narrativ der ökologischen Transformation des Wirtschaftens viel Hoffnung auf den Versprechungen der Bioökonomie, welche in den letzten Jahren „als eine Art Zauberformel für die Lösung vielfältiger Probleme präsentiert“ und von der EU schon 2012 als „radikaler Wandel unserer Art zu produzieren und zu konsumieren bezeichnet“ wurde. Auch die deutsche Bundesregierung hat Ende des ihr eigens gewidmeten Wissenschaftsjahres 2020 die Bioökonomie noch einmal mit einem Strategiepapier bedacht: Ihr vorrangiges Versprechen ist dabei „ein auf nachwachsenden Rohstoffen basierendes Wirtschaftssystem“, welches die aktuell fossile Rohstoffbasis sowohl in der Herstellung von Energie als auch anderer Arten stofflicher Produkte durch Biomasse zu ersetzen versucht. Lettow (2020) benennt hierbei anschaulich beispielsweise Schuhsohlen aus Pilzen oder Flugtreibstoff aus Algen. Für all dies braucht es naturwissenschaftliche Erkenntnis und technische Innovation. Nicht unumstritten setzt Letztere dabei maßgeblich auf die Genmanipulation von Leben. So können in den Forschungslaboren der Bioökonomie mittels der synthetischen Biologie „lebendige, sich selbst regenerierende Organismen“ erzeugt werden, die sich dann „entsprechend der gewünschten Kriterien gestalten und ökonomisch nutzen“ lassen. Damit aber steht die Bioökonomie auch „für eine neue Qualitätsstufe der wirtschaftlichen Verwertung der Natur und damit [für] eine Verabsolutierung des ökonomischen Denkens sowie eines industriell-technologisch geprägten Leitbildes.“ An dem gesteigerten Modus der Verwertung der Natur, an dem technisch vermittelten menschlichen Zugriff auf eine als Ressource behandelte Natur, an der Gestaltbarkeit des Lebens durch Formen des Wissens und der Manipulation zeigt sich das oben angesprochene dichotome Denken der europäischen Wissensgeschichte: Nun, in den Forschungslaboren der Bioökonomie wird es neuerlich angewandt und wiederaufgeführt, um eine als nachhaltig (im Sinne der Erhaltung des wirtschaftlichen Status Quo) imaginierte Zukunft herbeizuführen. Es ist die alte Erzählung der Trennung von Natur/Kultur, eine Geschichte der hierarchischen Begegnung, der Ordnung und Unterordnung von Natur zum Zwecke der eigenen Bevorteilung, es ist ein Epos der Ausbeutung und des Profits – die menschliche Naturbemächtigung schreibt sich im Handlungsablauf fort, soll die Zukunft gestalten.
In diesem Sinne treten im Forschungslabor der Bioökonomie unterschiedliche Zeiten miteinander in Kontakt: Eine sich seit Jahrhunderten forttragende Form des Wissens, welche auf der Trennung von Natur/Kultur beruht, wird in der Gegenwart angewandt, um bestimmte Formen des Zukünftigen herbeizuführen. Doch nicht nur auf zeitlicher, sondern auch auf räumlicher Ebene zeigt sich erneut die vielschichtige Brückenfunktion des Labors als Heterotopie: Mit Blick auf die ethischen Diskussionen rund um Genmanipulation und der damit verbundenen Schaffung und Gestaltung von Leben lässt sich erkennen, dass das Forschungslabor ein umkämpfter Ort der Gegenwart ist. Konflikte und Diskussionen um die Patentierung genetisch modifizierter Natur ergänzen dieses Bild. Am Beispiel von genmanipuliertem Maissaatgut, welches widerstandsfähig gegenüber veränderten klimatischen Bedingungen und Schädlingsbefall sei, dabei aber auch höhere Ernteerträge erzielen soll, lässt sich zumindest ein (auch) an Profiten orientiertes Interesse der Forschung und Innovation erkennen. Um in diesem Beispiel zu bleiben: Wenn technisch-kulturell hervorgebrachter Mais dann auch noch als Ressource für Biokraftstoff verwendet werden soll, kann entlang der Diskussion von „Teller oder Tank“ ein Zielkonflikt der Bioökonomie nachvollzogen werden: Die Anbauflächen der Erde sind begrenzt und es sind diese planetaren Grenzen, die zu umkämpften Räumen der imaginierten Zukünfte werden. Wenn von einer wachsenden Weltbevölkerung ausgegangen wird, dann gibt es auch weltweit einen erhöhten Lebensmittel-, Energie- und Rohstoffbedarf. Sollte nun tatsächlich eine Transformation der Wirtschaft im Sinne der Bioökonomie stattfinden, wird eine gigantische Menge an Biomasse – und entsprechende Äcker, um diese zu produzieren – benötigt, um den Bedarf der Weltgesellschaft zu decken, wobei auch über „die extrem ungleiche Ressourcenbeanspruchung“ und „die globale Verteilungsdimension“ dieser im Kapitalismus lebenden Weltgesellschaft nachgedacht werden muss. Gerhard befürchtet, „dass vor allem die Armen des Globalen Südens die Zeche für eine verstärkte Nachfrage nach Biomasse zahlen müssen.“ Daher sind es nicht nur Fragen nach menschlichem Zugriff auf Natur und Leben, nach der Vormachtstellung Weniger durch Wissen und Patente, die in den Laboren der Bioökonomie verhandelt werden, sondern es ist auch ganz praktisch eine Frage danach, an welchen Orten, bzw. auf welchen Äckern dieser imaginierten Zukunft Biomasse wo, für wen und wofür produziert werden soll. Somit treten die umkämpften Räume der Gegenwart mit denen möglicher Zukünfte im Labor als Heterotopie in Verbindung.
So zeigt sich abermals, dass „die gesellschaftspolitische Rolle von Wissenschaft und Technologie im Sinne der Lösung von großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ zuvorderst technizistisch-innovativ interpretiert, im Modus kapitalistischer Interessen umgesetzt und ohne systemkritische Ambitionen weiterbetrieben wird. Außerdem ist erneut zu erkennen, dass die Frage, wer für wen welche Geschichte erzählt – und dabei Probleme identifiziert, Lösungen und Zukünfte imaginiert – unbedingt gestellt werden muss. Auch, wenn multiple Krise und Anthropozän die Menschheit an sich als geologischen Faktor kennzeichnen, fehlt diesem Diskurs jedoch eine differenzierte Sicht auf die Menschheit, eine Sensibilität dafür, dass nicht alle gleichermaßen an den erdsystemischen Krisen Verantwortung tragen, an Strategien des Umgangs mit dem Anthropozän partizipieren dürfen und/oder können und auch nicht alle im selben Maße von künftigen Veränderungen des Planeten betroffen sein, bzw. von den getroffenen Maßnahmen profitieren werden.
So erzählt der Narrativ einer grünen Ökonomie ausgehend von den sich ändernden erdsystemischen Materialitäten und unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit zwar von der Notwendigkeit zu handeln und Veränderungen herbeizuführen, doch entpuppt sich die so imaginierte Zukunft als ein „weiter so“ lediglich in einer anderen Farbe. Imaginiert wird ein „weiter so“, das vorrangig Innovation und Technik innerhalb des alten Dualismus Natur/Kultur nutzen möchte, um Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse in den kapitalistischen Mensch/Mensch und Mensch/Natur-Beziehungen aufrecht zu erhalten. Solche Hardwarelösungen entbehren dabei leider jeglicher Reflexion über diese schon so lange bestehenden Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse und der Bedeutung der ihnen zugrunde liegenden dichotomen Trennung von Natur/Kultur.
Allerdings werden gerade in neuen und anderen Erzählungen, durch Geschichten mit unterschiedlichen Handlungsabläufen, veränderten Formen des Wissens Möglichkeiten gesehen, der multiplen Krise der Gegenwart in einem veränderten Modus des Denkens und Handelns begegnen zu können. Da in vielen Ansätzen mitunter die Dichotomie von Natur/Kultur (nicht nur) für die Umweltprobleme der Moderne verantwortlich gemacht werden, bietet das Auflösen und Hinterfragen alter Dualismen großes politisches Potential. In Anbetracht der multiplen Krise und durch Vorstellungen darüber, wo diese herrührt, welche Narrationen und Denkmuster ihr zugrunde liegen und in der diese Krise herbeigeführten Gesellschaftsform namens Kapitalismus so tief verankert sind, wird erkennbar, dass es nicht die entfesselten technischen und ökonomischen Kräfte sein können, nicht ein Fortschreiten und Verbreiten dieser Kultur sein kann, welche einzig Auswege aus der Krise aufzuzeigen vermögen. Die aus solchen Narrativen der Gegenwart hervorgehenden Imaginationen sind mit Blick auf ihre Genealogie zu hinterfragen. Um die Krisen der Gegenwart überwinden zu können, sind vielmehr „gesellschaftliche Veränderungen in Richtung einer „moralischen“, solidarischen, genossenschaftlichen Ökonomie gefordert“. Wenn die gegenwärtigen und globalen Krisendynamiken als ein kapitalistischen Produktions- und Konsumtionsverhältnissen inhärentes Kernproblem aufgefasst, also als ein kulturelles Problem, als ein Problem der Denktraditionen erkannt – und nicht ausschließlich an erdsystemischen Materialitäten abgelesen – werden, dann ergeben sich aus solchen neuen Erzählungen auch andere Imaginationen von Zukünften, eröffnen sich Freiräume für die Gestaltung postkapitalistischer Zukünfte.
So möchte auch die in diesem Text vorgenommene Erzählung mit einem hoffnungsvollen Ausblick schließen.
Denn letztlich geht es um den Umbau der kapitalistischen Industriegesellschaft im Weltmaßstab. Nun stellen aber Wissenschaft, Weltmarkt und Politik vom Westen dominierte Institutionen dar, die dem Rest der menschlichen und nicht-menschlichen Welt ihre Ordnungsentwürfe globaler Verhältnisse aufzwingen und dabei nicht erkennen können oder wollen, dass unser Lebensstil auf Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnissen beruht und unsere hierfür grundlegenden Denkkategorien – die Trennung von Natur/Kultur – keine ewig währenden Wahrheiten, sondern historisch bedingte sind. Daher müssen an den nichtinstitutionalisierten Orten, in kleinen Gruppen, in unterschiedlichen Räumen, eigene, diverse Geschichten erzählt werden, sodass auch die Imaginationen dessen, was herbeigeführt werden soll, sich von den Erzählungen der allzu dominanten Sprecher:innen, von den Narrativen eines kapitalistischen Hegemon unterscheiden. So müssen neue und vor allem herrschaftsfreie Ordnungsentwürfe entstehen, in denen die Beziehungen und Positionen von Mensch, Natur und Technik, von Wohlstand und gutem Leben, von dem Verhältnis belebter und unbelebter Materie und von Wissen überhaupt, umstrukturiert werden können und dürfen. Genau dafür ist es „dringen notwendig, gemeinsam und neu, quer zu historischen Differenzen und zwischen allen möglichen Wissensformen und Expertisen zu denken.“
Daher gilt der letzte Hinweis dieser Erzählung einer gewissen chinesischen Enzyklopädie, welche Erwähnung in Borges (1966) Schrift „Die analytische Sprache John Wilkens“ findet und auch von Foucault (1974) im Vorwort zu „Die Ordnung der Dinge“ aufgegriffen wird. Sie soll den Lesenden als ein inspirierendes Beispiel eines Ordnungsentwurfes dienen, welcher zunächst befremdlich wirken, dadurch jedoch auch die Dringlichkeit der Hinterfragung der in einem selbst festgeschriebenen Ordnungen aufzuzeigen vermag:
„die Tiere, die sich wie folgt gruppieren:
a) Tiere, die dem Kaiser gehören,
b) einbalsamierte Tiere,
c) gezähmte,
d) Milchschweine,
e) Sirenen,
f) Fabeltiere,
g) herrenlose Hunde,
h) in diese Gruppierung gehörige,
i) die sich wie Tolle gebärden,
k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind,
l) und so weiter,
m) die den Wasserkrug zerbrochen haben,
n) die von weitem wie Fliegen aussehen“
(Borges, 1966)
Biografie
Nils Mojem
Nils Mojem hat seinen Kombi-Bachelor in den Fächern Germanistische Linguistik und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin gemacht und studiert dort seit 2018 im Master Kulturwissenschaft. Er ist seit 2020 als studentischer Mitarbeiter am Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin als auch am Institut Futur der FU Berlin tätig. Stets im Kontext nachhaltiger Entwicklung und sozial-ökologischer Transformation und Umweltveränderungen situiert, reizt ihn besonders eine Position im „Dazwischen“ – an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen und den Berührungspunkten von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.